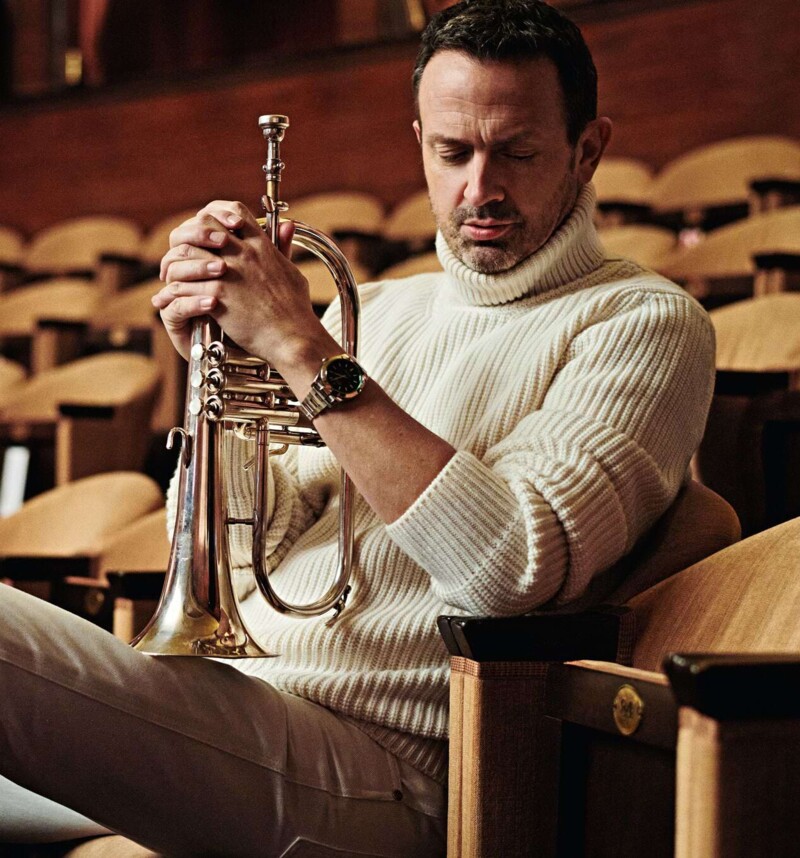Genesis
Jacky Ickx und der Genesis X Gran Berlinetta Tribute
Die Zeit kann man bekanntlich nicht anhalten. Also genießt man Sie besser. Und schreibt dann gleich noch seine persönliche Geschichte neu. Oder weiter. So, wie es Genesis und Jacky Ickx gemeinsam tun. Mit dem Genesis X Gran Berlinetta Tribute.
Die Zeit kann man bekanntlich nicht anhalten. Also genießt man Sie besser. Und schreibt dann gleich noch seine persönliche...